Ja, diese Überschrift ist zweideutig. Vielleicht auch ein bisschen zynisch. Und ja, die Entscheidung über die richtige Lesart mögen bitte Sie fällen. Mein Thema ist die ersatzreligöse Debatte um das rechte Verhältnis zur Medienzukunft. Dieser ständige Wesenstest: Bist Du für Google oder gegen SPIEGEL 3.0? Glaubst Du an die Segnungen der digital vernetzten Zukunft oder ans Journalisten-Sterben? Es ist bald Weihnachten, kommen wir zur Besinnung!
Große Aufregung um Google und SPIEGEL. In Diskussionen um den Medienwandel als Dauerzustand geht es besonders hoch her, wenn diese Symbolmarken betroffen sind. Kürzlich lasen wir von der „Zerschlagung“ des Konzerns, nur weil das EU-Parlament sich mit der Marktmacht des US-Suchmaschinen-Konzerns beschäftigt hatte. Und beim Hamburger Leitmedium wurde, vielbeachtet, das Führungs-Duo ausgewechselt, nach monatelangen „Grabenkämpfen“ zwischen Digital- und Printkollegen, wie es gemeinhin hieß.
Mission Zukunft
Jetzt wo die Erregungswellen wieder abebben – und bevor die nächsten heran rollen – würde ich gern ein bisschen auf den Grund sehen: Denn mich interessiert die Motivation dieser Emotion.
Im Ergebnis haben mich die jüngsten Debatten vor allem eines gelehrt: Die digital vernetzte Zukunft bleibt eine Glaubensfrage. Aber Vorsicht: Ob nun frühere Kreuzzüge oder heutige Deutungsschlachten, mit derlei Instrumenten tarnt man stets Machtinteressen. Sinnstifter erweisen sich im Nachhinein manchmal eher als Anstifter.
Gut, das Gleichnis vom Internet als „Ersatzreligion“ ist alles andere als neu. Aber seine Erklär-Kraft hilft, solange wir dieses Bild nur dazu nutzen, um uns die Prozesse zu veranschaulichen. Täglich erleben wir doch weihevollen Prophetien und brutale Apokalypsen für „das Netz“ und verfolgen die Stiftung von „Communities“ gleichgesinnter Follower / Jünger.
Ob nun in Form von Untergangsphantasien oder Erweckungserlebnissen, Beruf und Berufung des Journalismus wird dabei nach meiner Wahrnehmung immer stärker zum Thema. Es sind noch Spezialdiskussionen „interessierter Kreise“, aber diese Kreise haben sich über die unmittelbare Medienbranche hinaus erweitert.
Hochamt Journalismus
Diese Aufmerksamkeit hat ihren guten Grund in der Schlüsselfunktion der Profession. Jeffrey C. Alexander, Kultursoziologe an der Yale Universität, pointiert diese Rolle im Interview bei FR-Online:
„Journalisten sind die Priester und Schamanen des Informationszeitalters.“
Es ist durchaus ein widersprüchlicher Status, angesehen und gefürchtet, gleichermaßen beliebt wie verhasst. Aber im Ergebnis irgendwie unverzichtbar. Aus dem wilden Ringen um die Schlüsselposition der Kommunikation, können Journalisten/innen durchaus Hoffnung für die Zukunft schöpfen, allen „Zeitungstod“-Szenarien zum Trotz. Jeffrey Alexander auf FR-online:
„Ich empfehle Journalisten daher, ihr Metier „in Transformation“ zu begreifen und darauf zu vertrauen, dass sie sich in diesem Prozess behaupten können, indem sie nicht so sehr technologiegläubig, sondern qualitätsbewusst agieren.“
Für mich eine gelungene, weil differenzierte Alternative sowohl zur Fortschrittseuphorie als auch zum Marktradikalismus, mit dem der New Yorker Journalismus-Professors Jeff Jarvis in der ZEIT kürzlich zu Googles Gunsten intervenierte. Jarvis ist, ein bekennender und smart argumentierender „Internet-Evangelist“, macht sich in seinem Gastbeitrag sich öffentlich Sorgen über die Folgen deutscher „Fortschrittsfeindlichkeit„:
„Am meisten beunruhigt mich allerdings die Beschädigung des Internets, seiner Freiheiten und seiner Zukunft, denn so werden die Möglichkeiten beschnitten, die ein freies Internet allen Menschen überall bieten kann. Drei Kräfte sind es, die das Internet gefährden: Kontrolle, Protektionismus und Technopanik.“
Panik, Hass und Phobie – mir fällt häufig auf, dass die digitale Diskurs-Elite gerade Google-Kritikern krankhafte Gefühle unterstellt. Als unmittelbarer Ärger über die Lobby-Arbeit von Großverlagen oder als allergische Reaktion auf Kulturpessimismus ala „Digitale Demenz“ (Spitzer) wäre diese Abwertung von skeptischen Positionen, beispielsweise beim Datenschutz, noch verständlich.
Aber der radikale Schwung, dieser irreparabel geplatzte Kragen, scheint mir einen anderen Grund zu haben: Der Streit geht um mangelhafte Motivation zur Vision. Deshalb wird eine positive Haltung gegenüber Google & Co mittlerweile zu einer Art Wesenstest der persönlichen Zukunfts- und Zurechnungsfähigkeit.
Jaron Lanier lieferte mir in seinem Buch „Wem gehört die Zukunft?“ (2014) eine schöne Erklärung dieser Erregung. Die Anhänger der digital vernetzten Gesellschaft brauchen für deren Umsetzung Optimismus, nicht grüblerische Trübsal. Zwischen Optimismus und Leistung sieht Lanier einen Zusammenhang, der „typisch amerikanisch“ sei.
Denn selbst nüchterne Technologen, so der „Computerwissenschaftler“ (Buchklappentext) Lanier, brauchen eine spirituelle Quelle, Fortschrittsglauben eben:
„Wir glauben, dass die Zukunft durch unsere Arbeit besser sein wird als die Vergangenheit. Die negativen Nebenwirkungen, davon sind wir überzeugt, werden nicht so schlimm ausfallen, das gleich das gesamte Projekt ruiniert ist. Wir drängen immer weiter voran, ohne genau zu wissen, wohin wir eigentlich gehen.“
Blick in den SPIEGEL
Treiben wir jetzt die Religions-Metapher mal auf die Ericus-Spitze: War der ehemalige SPIEGEL-Chefredakteur Wolfgang Büchner ein verkannter Erlöser? Oder hatte doch eher Edel-Autor Cordt Schnibben recht, mit seinen ketzerischen Bemerkungen über die Vision „SPIEGEL 3.0“ und dessen entthronten Visionär?
Schwache Charaktere wie ich vermuten die Wahrheit natürlich irgendwo dazwischen. Mir kommt es so vor, als habe Wolfgang Büchner beim SPIEGEL den typischen Change Management-Auftrag erhalten: „Liefern Sie uns mal einen eckigen Kreis“. Anders ausgedrückt: „Organisieren Sie tiefgreifenden Wandel ohne Konflikte, Risiken und Verluste.“ Wer ist nun der Doofe? Derjenige, der so einen Auftrag erteilt oder der, der ihn annimmt?
Büchner halte ich für menschlich integer und fachlich kompetent, wobei ich nur einmal mit ihm zu tun hatte. Vor den Texten eines Cordt Schnibben knie ich seit Jahrzehnten innerlich nieder. Meinetwegen müssen die nicht einmal multimedial von braunstichigen Comics flankiert werden. Aber das gehört sich vielleicht so für einen Innovations-Scout.
Jedenfalls kann ich auch SPIEGEL-Print-Edelfedern wie Schnibben verstehen, wenn sie sich nicht in die Ecke der Zukunfts-Untauglichen stellen lassen wollen. Sein Facebook-„Rant“ gegen den „SPIEGEL 3.0“ wurde als mutiger Standpunkt oder als Nachtreten aus Eigeninteresse interpretiert, je nach Lager.
Buzzword „German Angst“
Nun aber Schluss mit meiner verschwurbelten Sowohl-als-auch-Argumentation. Prominente Diskutanten laden komplexe Konflikte lieber zu Gut-Böse-Szenarien auf, deren Titel zwar nicht an die Bibel, aber immerhin an den „Herrn der Ringe“ oder „Star Wars“ erinnern. Unter der Überschrift „Spiegel vs. Online – das Erwachen der Macht“ verbloggt der unternehmungslustige Medienprofi Richard Gutjahr eine Warnung an die Beharrer und Bewahrer und verkündigt:
„Wir Journalisten sollten keine Angst haben vor der Zukunft. Wovor wir wirklich Angst haben sollten: dass wir sie nicht mehr erleben.“
Angst, den Anschluss zu verpassen. Gutjahr verfügt über Kompetenz und Gespür für die Situation. In der Tat ist es für die deutsche (Internet-) Wirtschaft und Technologie-Elite höchste Eisenbahn, die Bremsen zu lockern anstatt darüber nachzudenken, ob einem auf der Fahrt schlecht werden könnte. Nachvollziehbar, zumal die internationale Konkurrenz bereits heftig unterwegs ist.
Hoffnung ja, Fatalismus nein
Trotzdem muss eine Gesellschaft sich dafür interessieren, wohin die Reise geht. Der Glaube an eine schöne Zukunft darf nicht zu blindem Vertrauen in eine herrschende Technologen-Klasse führen. Sie sind nicht die Hohepriester einer naturgleichen digitalen Offenbarung, sondern Ingenieure gesellschaftlicher Entwicklung. So setzen auf ihre Art einen Rahmen, in den die Menschen noch hineinpassen müssen.
Selbst die digitale Zukunft ist gestaltbar und sogar regulierungsfähig. Die New York Times etwa fordert dieser Tage unter der Überschrift „We can`t trust uber“ strenge Datenschutzregeln für den Online-Vermittler von Fahrdiensten und verweist dabei ausgerechnet auf die EU, auf Old Europe. Es ist mühsam, aber Werte und Wirtschaft müssen immer wieder aneinander angeglichen werden.
Auf diesen Unterschied kommt es an: Die gesellschaftliche Aufgabe des Journalismus und die geschäftlichen Modelle der Medien haben zwar sehr viel miteinander zu tun. Dennoch sind sie nicht identisch! Es wäre zu simpel, es beispielsweise auf die Alternative „Bist Du Visionär oder sorgst Du Dich um Deinen Besitzstand?“ zu reduzieren. Freiheit und Sicherheit sind gleichberechtigte Bedürfnisse, die nicht ständig gegeneinander ausgespielt werden dürfen.
Es führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei: Wir müssen alle dran glauben. So oder so. Keiner kennt die Zukunft und seinen Platz darin. So banal – oder profan – es klingen mag, die richtige Haltung liegt in der klugen Mischung aus Skepsis und Optimismus. Eine aufgeklärte Aufmerksamkeit, mit der wir erkennen, wenn der Glaube an das Gute oder die Sorge über die Probleme der digitalen Entwicklung in blanken Fanatismus oder berechnete Demagogie umschlagen.
Denn beides würde auf Dauer in die Irre führen. Wer tatsächlich glaubt, nur den Marktkräften freien Lauf lassen zu müssen, wird damit genauso eine schlechte Medienzukunft erzeugen wie derjenige, der die wirtschaftlichen Grundlage und die technologischen Umbrüche der Branche einfach aussitzen will.
Wir wären damit bei einem Ansatz angelangt, der beide Aspekte berücksichtigen, der Interessen ausgleichen könnte. Eine Art „soziale Medienwirtschaft“, die zwischen Technopanik und Fortschrittswahn vermittelt. Schließlich gab es einmal Zeiten, in denen dieses deutsche Modell durchaus international angesehen und wettbewerbsfähig war. Hashtag „Guter Vorsatz“.
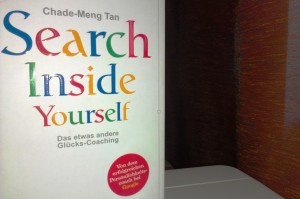


[…] praktischen Beispiel: Beim Streit um die Macht oder Ohnmacht von Google geht es nicht darum, ob es Regeln für das Internet gibt, […]