Worte dieser Wochen: Macht. Kampf. Sie prägen die vielen täglichen Kriegsnachrichten und so manche Berichte von der Medienfront. Exemplarisch: Spiegel-Chefredakteurs Wolfgang Büchner ringt mit großen Teilen seiner Redaktion um die digitale Zukunft. Blut floss zwar nicht, aber Opfer wird es geben, strukturell und personell. Geht es in diesem modellhaften Kampf doch um einiges, nicht zuletzt um die Regeln im Spiel um die Macht im Journalismus.
Gerade schweigen die Kombattanten, ruhen die Petitionen: Nach einer „Ja, aber erst mal mit den Kritikern reden“-Entscheidung der Gesellschafter zum Konzept „Spiegel 3.0“ warten interessierte Beobachter nun auf den Ausgang der internen Friedensverhandlungen. Das Nachrichtenmagazin wird so selbst zur Nachricht, wenn auch nicht im eigenen Blatt.
Denn wer heute (dies ist sozusagen ein Montags-Post) in das gedruckte Magazin guckt, der findet eine Reihe interessanter Aspekte zum Thema: Einen Essay über Macht (der Angela Merkel), gleich mehrere Geschichten zum digitalen Medienwandel (Innovativer Journalismus, Verschwinden der Mittelschicht, Drohnen als Kulturmittel) sowie einen Bericht über Redaktionsquerelen. Allerdings beschreibt der den internen Streit bei der FAZ um einen Artikel zum, ja klar, „Zeitungssterben“. Das Ringen der anderen.
Modellfall Spiegel
Ja was macht für uns Außenstehende den Spiegel-Konflikt denn eigentlich so interessant? Außer dass Betriebsklatsch immer zieht?
Dies liegt vor allem an der Bedeutung der strahlenden Medienmarke Spiegel für unsere Wirklichkeitskonstruktion im Informationszeitalter. Ob nun online oder offline. Hinzu kommt, dass die Auseinandersetzung um Büchners neues Konzept im ursprünglichen Sinne vorbildlich ist. Typisch in ihrer Art und vermutlich folgenreich in ihrem Ergebnis. Ich behaupte: Auch über die Hamburger Verhältnisse hinaus. Ein Konflikt mit Modellcharakter.
Wer dagegen den Kampf um „Spiegel 3.0“ entweder als Befindlichkeit Ewigvorgestriger oder Change Management-Versagen des Chefredakteurs sieht, der tut beiden Seiten unrecht. Der unterschätzt viele bedenkenswerte Argumente der Traditionalisten genauso wie die enorme Prozesskompetenz Büchners. Weder mag ich annehmen, dass es den Widersachern der Spiegel-Spitze nur um ihren – eindrucksvollen – Besitzstand geht, noch kann ich so ohne weiteres glauben, dass Büchner ein Versager in Kommunikation oder Management ist.
Wobei ich zugeben muss, kein wirklicher Insider zu sein. Aber gerade aus der Zaungast-Perspektive des Outsiders eröffnet diese Spiegel-Affäre einen analytisch anregenden Blick auf das aktuelle digitale Change Management. Oder sagen wir besser: auf eine entscheidende Schlacht im medialen Machtkampf. Dazu vier Thesen:
1. Medienwandel erfordert jetzt Richtungsentscheidungen
Wir stehen gewissermaßen am Ende vom Anfang. Digitaler Wandel kam lange wie ein offenes Diskussions-Projekt daher, ein weites Feld der Möglichkeiten und Zumutungen. Über den richtigen Weg in die Zukunft konnte man trefflich streiten, gerade im Internet selbst. Das taten die Tollen und die Trolle ja immer noch reichlich.
In der Flüssigen Moderne wird es auch keinen Zeitpunkt völliger Festlegung mehr geben, alles wird im Fluss bleiben. Aber dieser digitale Fluss wird technisch wie ökonomisch in Richtungen gelenkt. Bei aller Sehnsucht nach der Vergangenheit und bei allen Träumen von der Zukunft, wir sollten wir uns im Wortsinne „vergegenwärtigen“, dass gleichwohl bereits jetzt ständig Entscheidungen fallen.
An ein paar aktuellen Beispielen sehen wir, wie kräftig dabei Macht bereits (um-)verteilt wurde. Etwa an den Onlinehändler Amazon, gegen den Verlage und Autoren aktuell so eindrücklich aufbegehren. An die Hüter der Filter bei Twitter und Facebook, die ihre Nutzer ungewollt zu Forschungsobjekten oder zu Zwangs-Beglückten machen. Nein, die monopolartige Stellung von Google erwähne ich an dieser Stelle mal nicht (ups).
Zu den stärksten Argumenten gegen vor Tagen präsentierten „Digitalen Agenda“ der Bundesregierung zählt ihr offenkundiges Zeitspiel. Während Deutschland noch prüft, dürfte andernorts bereits Fakten geschaffen werden. Angesichts der offenkundigen Wettbewerbsdynamik versucht die Spiegel-Spitze verständlicherweise, den bisherigen Spagat zwischen Print und Online aufzulösen. Um auf diese Weise handlungsfähig zu werden. „Verschmelzung der Bereiche Print und Online“ verspricht das Konzept von Chefredakteur und Verlagsgeschäftsführer. Ein Verharren in der bisherigen Position würde nach aller Erfahrung tatsächlich auf Dauer nur zu stärkeren Schmerzen führen.
2. Die nächste Generation drängt an die Macht
Zwischen „Printleuten“ und „Onlinern“ verläuft beim Spiegel die branchenübliche Streitlinie, welche offenkundig unterschiedliche Berufsauffassungen trennt. Auf der einen Seite eher traditionell orientierte, literarisch- intellektuelle Edelfedern und auf der anderen technisch-kreative, Kommunikationsprofis. Dies ließe sich vermutlich weniger klischeehaft beschreiben, als ich es gerade getan habe. Kommt trotzdem hin.
Die Richtungsentscheidung – traditionellen Markenkern bewahren oder innovatives Digital-Branding vorantreiben – hängt eng damit zusammen, wem die Entscheider mehr Zukunft zutrauen. Damit sind wir bei der Generationenfrage, wenn auch nicht unbedingt als reine Altersfrage. Denn Angehörige der gleichen Jahrgänge können durchaus ein fundamental unterschiedliches Verhältnis zu denselben Themen haben. (Darin liegt ein häufiges Missverständnis, wenn es um die Kompetenzen von Digital Immigrants und Digital Natives geht.)
Ausgehend von den beschriebenen Unterschieden, könnten wir beim Spiegel – und nicht nur dort – vielleicht von einer „Generation Tradition“ im Gegensatz zu einer „Generation Innovation“ sprechen. Man würde dann hinsichtlich des Alters Vermutungen darüber anstellen, wo mehr junge Leute zu verorten sind. Zunächst einmal ist aber entscheidend, welche Generation sich durchsetzt.
3. Beim Spiel der Macht ändern Sieger die Regeln
In diesem Machtspiel geht es jedoch nicht nicht nur darum, Sieger und Verlierer zu ermitteln, um sie dann mit Posten zu belohnen. Die Gewinner werden immer auch die strukturellen Regeln ändern. Um es mit dem Soziologen Pierre Bourdieu auszudrücken: Sie werden festlegen, welches persönliche „Kapital“ künftig notwendig ist, um eine hohe Position zu erlangen. Dieser Kapitalbegriff ist vielfältig, reicht von erworbenen Titel und Fähigkeiten über soziale Verbindungen bis hin zum schnöden Mammon. Auf dem Medienfeld reden wir über ein paar ganz besondere Ressourcen:
Was bringen im Journalismus demnächst noch Bildung, Kontakte und Schreibstil und wie wichtig werden bald Technikkompetenz, Vermarktungsverständnis und Experimentierfreude? Zählt Erfahrung weiter etwas und wenn ja, welche? Redet Journalismus an das Publikum oder mit dem Publikum?
Nehmen wir beispielsweise einmal an, dass der virtuose Umgang mit Worten beim Spiegel künftig nicht mehr ganz so wichtig ist wie der smarte Umgang mit Daten. Dann erfordert das natürlich andere Kompetenzen (Kapitalien) bei den Medienmachern. Das Kapital feuilletonistischen Schreiber wird entwertet, das der vernetzten Schrauber steigt im inneren (Macht-) Ranking.
Zur Debatte steht also nicht, welcher möglichst ewig gültige Qualitätsbegriff denn der richtige sei, sondern vielmehr die Frage, wer in Zukunft bestimmen darf, was beim Spiegel unter Qualitätsjournalismus zu verstehen ist.
4. Machtworte entscheiden nichts wirklich
Die Erklärung der Gesellschafter nach ihrem Krisentreffen am Freitag war knapp. Und trotzdem nicht ganz eindeutig. Medien-Branchendiensten fiel es daher nicht leicht, Sieger und Verlierer zu identifizieren. Zwar unterstützten die Eigner des Spiegels das Konzept von Chefredakteur und Geschäftsführer, knüpften dies aber gleichzeitig an eine Art Mediation mit der Redaktion. So etwas funktioniert nur, wenn beide Seiten sich einander annähern wollen.
Ob das klappt, werden die nächsten zwei Monate wohl zeigen. Machtworte legen im Medienwandel nichts mehr fest, sondern können bestenfalls einen Rahmen benennen, den Verhandlungsmodus für die Zukunft regeln. Nun haben es die Beteiligten in der Hand. Die verschiedensten Interessen miteinander ausgleichen, ohne die Linie in die Zukunft zu verlassen. Viel Erfolg!
Das Vorgehen ist typisch: In Change Management-Prozesses stehen die Beteiligten häufig vor dem gleichen Dilemma – einer Paradoxie der Aufgabenstellung: „Wasch uns gründlich den Pelz, Wasser wäre aber eher blöd.“ Es soll die notwendigen harten Einschnitte geben, die aber für alle OK sein müssen. Neue Wege gehen, alte Werte bewahren, Kompetenzen umverteilen und dabei mit alle mitnehmen. Tja …
Prognosen wären an dieser Stelle vermessen. Wie der modellhafte Machtkampf beim Spiegel ausgegangen sein wird, erfahren wir Leser und Nutzer wohl dann, wenn das „Sturmgeschütz der Demokratie“ seine Kanonen wieder nach außen richtet statt nach innen. Ziele gäbe es ja genug.
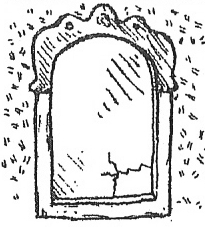


Deine Meinung ist uns wichtig