Es gibt Texte, die einen sehr aufregen. Nicht etwa, weil alles darin so neu oder provokant wäre. Sondern wegen ihrer schlichten Wahrheit und Klarheit. „Daten, Drohnen, Disziplin. Ein Gespräch über flüchtige Überwachung zwischen Zygmunt Bauman und David Lyon“, das ist für mich so ein Buch. Vor kurzem erst erschienen, könnte der Titel wie ein schnell zusammen gekloppter Kommentar zu Edward Snowdens Enthüllungen und der Diskussion um Spionage und Big Data wirken.
Aber dafür hätten sich die beiden Wissenschaftler wohl kaum hergegeben. Der Soziologe David Lyon von der Queen´s University in Kingston / Kanada gilt als einer der führenden Experten für Überwachung. Vom polnisch-britischen Soziologen und Philosophen Zygmunt Bauman stammt der Begriff „Liquid Modernity“. Kein Ausdruck beschreibt meiner Meinung nach so treffend die Verhältnisse des Digitalen Zeitalters.
Wozu diese Verflüssigung – im Buch ist von „Verflüchtigung“ die Rede – inzwischen geführt hat, wollen Bauman und Lyon ausloten, indem sie die allgegenwärtige, „flüchtige Überwachung“ in unserer modernen Welt diskutieren. Begonnen hat dieser Dialog ausgerechnet als Email-Wechsel. Immerhin sind die beiden somit keine ewig gestrigen Fortschritts-Ignoranten, auch wenn ihre kritische Haltung vermutlich zu genau diesem reflexhaften Vorwurf führen dürfte. NSA & Co hatten jedenfalls technisch wohl die Möglichkeit zur exklusiven ersten Lektüre, was ausnahmsweise nicht geschadet hätte. Denn es geht um Aufklärung zum Thema Überwachung. Solche Botschaften gehen alle etwas an, meinetwegen auch Spione.
Egal von welcher Warte aus betrachtet, verdient das Büchlein aus der edition Suhrkamp hohe Aufmerksamkeit. Gut, vielleicht bin ich aber auch nur so begeistert, weil das Gespräch der Soziologen mir so viele meiner Beobachtungen der letzten Zeit bestätigt. Möglicherweise stosse ich an die unsichtbaren Wände meiner „Filter Bubble“. Wem also das Folgende zu hymnisch wirkt – andersartige, kritische Rezensionen existieren natürlich auch.
Zygmunt Bauman liebt ganz offenbar Metaphern, was das Emailgespräch mit seinen interessanten, gelehrten Bezügen trotz trockener Thematik sehr plastisch macht. Gemeinsam mit seinem Gesprächspartner führt er uns die eigene Lage in der globalisierten Gesellschaft vor Augen. Welche grundsätzliche Verunsicherung die technologische Entwicklung für Menschen und Medien bedeutet, kommt selten so deutlich auf den Punkt wie hier.
Denn die Autoren benennen die Ursachen für eine Grundverunsicherung, die viele von uns nur diffus spüren, andere nicht erkennen können und wiederum andere nicht wahrhaben wollen: Wir stehen alle unter permanenter Kontrolle. Paradoxerweise ist es eine fremdbestimmte Eigenkontrolle, eine Entmündigung für Selbstabholer. Wir wollen dürfen müssen, oder so.
Anknüpfend an Michel Foucault, der sich wiederum auf den Briten Jeremy Bentham bezieht, gehen Bauman/Lyon von der Idee des „Panoptikums“ aus. Damit wird das architektonische Modell Benthams bezeichnet, in dem beispielsweise die Wächter eines Gefängnisses die Insassen jederzeit beobachten können, ohne dabei selbst gesehen zu werden. Auch ein Bezug zur„Kontrollgesellschaft“ nach Gilles Deleuze fehlt nicht.
Statt einer Nacherzählung, lasse ich nun einige Kernaussagen aus dem Gespräch von Bauman und Lyon wirken. Dabei souffliere ich eigene Fragen zur „flüchtigen Moderne“:
Was bewirkt der Digitale Wandel für gesellschaftliche Institutionen, Beziehungen, Haltungen? „Soziale Einrichtungen verdampfen schneller, als sie sich neu errichten lassen.“
Warum wird der technologische Fortschritt selten hinterfragt? „Der Glaube an technische Entwicklungen ist jedes mal wieder so groß, dass kritische Nachfragen als Blasphemie oder Sakrileg wahrgenommen werden.“
Inwiefern gibt es in der digitalen Welt einen „Sieg der Technik über die Ethik“? „Der wichtigste Effekt des Fortschritts in der Distanzierungs- und Automatisierungstechnologie ist die zunehmende und vielleicht unaufhaltsame Befreiung unseres Handelns von moralischen Skrupeln.“
Weshalb wird die uferlose Überwachung von so vielen einfach hingenommen? „Inzwischen sind die allermeisten von uns offenbar geradezu süchtig nach Sicherheit. Wir haben eine Weltanschauung verinnerlicht, die auf Allgegenwart von Gefahr und der unausweichlichen Notwendigkeit ständigen Misstrauens und Argwöhnens beruht und die sich das Zusammenleben innerhalb einer Nation nur unter dem Schutz ständiger Wachsamkeit vorzustellen vermag.“
Warum machen wir beim Überwachen mit? „Wir alle möchten, dass die Feinde der Sicherheit gekennzeichnet werden, um zu verhindern, dass man uns zu ihnen zählt.“
Weshalb wirkt die nationale Politik so ohnmächtig? „Die staatliche Institutionen ächzen unter der Aufgabe, lokale Lösungen für globale Probleme zu erdenken und bereitzustellen; aufgrund dieses Mangels an Macht kann der Staat diese Last nicht mehr schultern und seinen Aufgaben mit den ihm verbleibenden Ressourcen und seinen schrumpfenden Möglichkeiten nicht mehr nachkommen. (…) Die Funktionen, denen er sich nach und nach entschlägt, werden auf die untere Ebene verwiesen – in den Bereich der Politik des Lebensstil, in dem das Individuum das dubiose Privileg zukommt, seine eigene Legislative, Jurikative und Exekutive in einem zu sein.“
Was kennzeichnet das „Post-Privacy-Zeitalter“ der Sozialen Netzwerke? „Die Privatsphäre drang vor und kolonisierte die Öffentlichkeit – und verlor damit zugleich ihr Recht auf Geheimnisse, also auf ihr bestimmendes Merkmal, ihre am höchsten geschätztes und am heftigsten verteidigtes Privileg.“
Warum müssen wir online ständig irgendwelche Auskünfte über uns abgeben? „Die Grundidee des Database-Marketing ist es, den Zielpersonen vorzumachen, ihre Meinung würde erfasst und berücksichtigt, während es in Wahrheit nur darum geht, sie selbst zu erfassen und – natürlich zu weiteren Käufen zu verleiten.“
Was ist dabei die Rolle jedes Einzelnen? „Wie die Überwachung wird auch das Produktmanagement immer mehr zu einem Do-it-yourself-Job, und die damit verbundene Knechtschaft wird immer öfter freiwillig gesucht.“
Bei Descartes heißt es: „Ich denke, also bin ich“ (cogito ergo sum). Wie lautet die digitale Fassung? „Ich werde gesehen (beobachtet, bemerkt, erfasst), also bin ich“
Woran fehlt es? „Wir brauchen dringend kritische Stimmen, die die Frage nach dem Warum und Wozu stellen und sich erkundigen, ob irgendjemand eine Vorstellung davon hat, welche Folgen all das für die Menschheit haben wird.“
Manche Rezensenten finden es ärgerlich, dass die Gesprächspartner am Ende keine Patentlösung anbieten. Bauman stiftet eher eine grundsätzliche Hoffnung auf das menschliche Vermögen, Nein sagen zu können. Lyon dagegen sucht nach religiösen Antworten. Dass sich beide über so vieles einig sind, reduziert die Spannung bei der Lektüre etwas. Aber hitzige Beiträge werden schon von Frank Schirrmacher zuverlässig und häufig geliefert.
Wer wissen will, wie und warum beispielsweise der Beruf des Journalismus gerade verflüssigt, also liquidiert wird, der muss sich dieser Debatte stellen, der muss diesen Digitalen Wandel und seine Konsequenzen aushalten lernen, selbst wenn er/sie sich viel eher nach einem guten Seminar zum crossmedialen Storytelling sehnt.
Der folgende Satz zum Gespräch von Zygmunt Bauman und David Lyon ist zwar fiktiv, aber er wäre richtig: „Gut, dass wir darüber gesprochen haben.“ Dieses Art Gespräch darf nie abreißen.
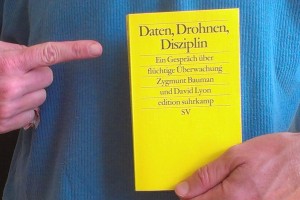


Deine Meinung ist uns wichtig